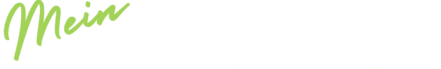Das EU-Parlament hat am 8. Oktober 2025 den umstrittenen Beschluss gefasst, vegane und vegetarische Produkte dürfen keine Namen wie „Schnitzel“, „Burger“ oder „Wurst“ mehr tragen. Dieses Verbot zielt darauf ab, Verwechslungsrisiken mit den echten Fleischerzeugnissen zu minimieren. Der Beschluss muss jedoch noch von den Mitgliedstaaten genehmigt werden, was eine intensive Debatte über die Auswirkungen des Gesetzes angestoßen hat, insbesondere in der Gastronomie und bei den Verbrauchern. Das berichtet die LVZ.
Die Leipziger Gastronomie zeigt sich über die Entscheidung verwundert. Kristoff Liebers, Gründer der „Vleischerei“, bezeichnet die Diskussion um das Verbot als übertrieben. Seine „Vleischerei“ nutzt kreative Begriffe wie „Cürrywürst“ und „Steäk“ für ihre Produkte, die auf pflanzlicher Basis bestehen. Liebers warnt, dass die tatsächliche Bedrohung für kleinere Betriebe eher von Großkonzernen ausgeht, als von den Namen, die sie für ihre Produkte nutzen.
Reaktionen aus der Gastronomie
Raphael Konieczny von der „Vleischerei“ sieht die Debatte als überholt an. Auch Andreas Grollmann von „Milu vegan“ äußert Bedenken und warnt vor der möglichen Verwirrung, die neue Bezeichnungen schaffen könnten. Tom Räntzsch, Inhaber des „Bibabo“, stellt die Sinnhaftigkeit des Gesetzes infrage und betont, dass sein Unternehmen bereits Fleischersatzprodukte unter alternativen Namen anbietet.
Die Kritiker des neuen Gesetzes glauben, dass es nicht nur Verwirrung stiften könnte, sondern auch einen erheblichen Aufwand für die Hersteller nach sich zieht. Zudem wird bemängelt, dass das Thema im Vergleich zu drängenderen Herausforderungen in der Lebensmittelindustrie wenig Priorität hat. Auf Social Media kursieren bereits Karikaturen und Witze über das Bezeichnungsverbot.
Verbraucherschutz im Fokus
Die Debatte wird nicht nur in der Gastronomie, sondern auch unter Verbraucherschützern heiß diskutiert. Diese wenden sich vehement gegen ein Verbot der Begriffe wie „Soja-Schnitzel“. Chris Methmann von Foodwatch kritisiert das Verbot als „Lobbyismus im Dienste der Fleischindustrie“ und betont, dass Verbraucher in der Regel klar zwischen veganen und fleischhaltigen Produkten unterscheiden können.
Zudem unterstützt die europäische Verbraucherorganisation BEUC die Forderungen der Verbraucherschützer und stellt fest, dass die Mehrheit der Konsumenten nicht durch die Begriffe verwirrt ist. Vielmehr fordern sie klare Kennzeichnungen anstelle eines Namensverbots, um die Transparenz zu erhöhen.
Die Datensituation zeigt, dass der Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch in Deutschland im Jahr 2024 bei 53,2 kg lag, während die Produktion von fleischfreien Alternativen 126.500 Tonnen erreichte, was einem Anstieg von 4,0 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Zahlen verdeutlichen das wachsende Interesse an pflanzlichen Ernährungsweisen, ein Anliegen, das auch in den Anfragen an die EU-Kommission behandelt wird. Fragen wie die Ausweitung pflanzlicher Produkte in Supermärkten und die Möglichkeit eines EU-weiten Etikettierungsprogramms stehen zur Diskussion und wurden in einem Schreiben an die Kommission formuliert, das im Europäischen Parlament eingereicht wurde.