Stadtentwicklung im Klimawandel: Leipzig setzt auf Schwammstadt!
Erfahren Sie, wie das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und Partner städtische Räume klimaresilient gestalten und anpassen.

Stadtentwicklung im Klimawandel: Leipzig setzt auf Schwammstadt!
Die Herausforderung des Klimawandels stellt städtische Regionen vor immense Aufgaben, insbesondere im Hinblick auf die zunehmenden Starkregenereignisse. Angesichts dieser Situation hat sich die Stadt Leipzig in Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) und anderen Partnern der Entwicklung von blau-grünen Infrastrukturen verschrieben. Diese neuen Ansätze sollen dazu beitragen, die urbanen Räume widerstandsfähiger gegen die Klimafolgen zu machen, indem sie die Prinzipien der wassersensiblen Stadtentwicklung umsetzen. Das Pariser Klimaabkommen fordert die Länder nicht nur zur Minderung des Treibhausgasausstoßes auf, sondern auch zur Entwicklung von Anpassungsstrategien an den Klimawandel. Im Zentrum dieser Strategien steht die Multifunktionalität des Raums, die einen naturnahen Wasserkreislauf schaffen soll. Dies umfasst die Versickerung und Verdunstung von Regenwasser vor Ort sowie die Speicherung des Wassers in sogenannten „Schwammstädten“. Helmholtz Klima berichtet, dass in Leipzig eine Analyse für ein 25 Hektar großes Neubauquartier durchgeführt wird, das Platz für etwa 3.700 Menschen bieten soll.
Die Umsetzung der blau-grünen Infrastrukturen beinhaltet sowohl naturbasierte Elemente wie Teiche, Parks und Bäume als auch technische Systeme wie Mulden, Rigolen und Gründächer. Diese Kombination ist entscheidend, um die Risiken von Überflutungen, Hitzeperioden und Trockenheit zu mildern. Ein wissenschaftsbasiertes Planungstool wird eingesetzt, um die Auswirkungen von Starkregen und Dürreereignissen zu berechnen und zu modellieren. Zudem soll das zentrale Abwassersystem entlastet werden, indem Regenwasser nicht mehr in die Kanalisation geleitet wird.
Schwammstadt: Ein zukunftsweisendes Konzept
Das Konzept der „Schwammstadt“ wird als Schlüssel zur Anpassung an den Klimawandel gesehen. Dieses Konzept ist auf die Speicherung, Nutzung, Verdunstung, Versickerung und Ableitung von Regenwasser ausgelegt. Untersuchungen der IOEW zeigen, dass umfassende Veränderungen im bestehenden sozio-technischen System erforderlich sind, um diese Infrastrukturen effektiv umzusetzen. Dazu gehört die Entwicklung eines Mixes aus Politikinstrumenten, die die Etablierung der blau-grünen Infrastruktur fördern. Der erste Projektteil konzentriert sich auf die Realisierung des Schwammstadt-Prinzips, während der zweite Teil die Modernisierung von Dächern durch Begrünung und Solaranlagen umfasst.
Ein bedeutendes Ziel dieser Initiative ist die Identifikation der zehn wirksamsten Hebel, die für die Transformation zur klimaresilienten Schwammstadt nötig sind. Um dieses Ziel zu erreichen, werden umfangreiche Literaturrecherchen und Workshops mit Experten durchgeführt. Die Anstrengungen umfassen auch die Unterstützung für Kommunen und Eigentümer durch Musterlösungen, Handreichungen und Empfehlungen für Ausschreibungen. Erste Ergebnisse wurden im September 2024 auf einer Tagung der Society of Environmental Toxicology and Chemistry präsentiert.
Klimaschutz und Energieeffizienz
Ein weiterer zentraler Aspekt des Projekts ist die Verbesserung der Energieeffizienz in den neu gestalteten Stadtquartieren. Durch die Maßnahmen sollen nicht nur klimatische Herausforderungen adressiert, sondern auch signifikante Einsparungen bei den Energiekosten erzielt werden. Um die Ansprüche der Bevölkerung zu erfüllen, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren erforderlich, um sicherzustellen, dass die Lösungen den Bedürfnissen der Gemeinschaft entsprechen.
Die Umsetzung dieser innovativen Konzepte ist nicht nur entscheidend für die Lebensqualität der Stadtbewohner, sondern leistet auch einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz. Die Integration von blau-grünen Infrastrukturen stellt somit einen bedeutenden Schritt in Richtung einer resilienten, klimafreundlichen urbanen Zukünfte dar.
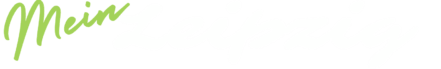
 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto
