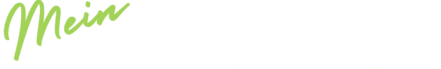In einem aktuellen Entwurf beabsichtigt Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche die Abschaffung der Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen, was erhebliche Auswirkungen auf Hausbesitzer hat. Derzeit beträgt die Einspeisevergütung 7,86 Cent pro Kilowattstunde und sinkt in regelmäßigen Abständen um 1%. Diese Maßnahme würde bedeuten, dass zukünftige Betreiber von Solaranlagen nur noch den Preis erhalten, den ihre Netzversorger bereit sind zu zahlen, was die wirtschaftliche Planung und Kalkulation deutlich erschwert. Berichten von Stuttgarter Nachrichten zufolge bleibt die Einspeisevergütung für bestehende Anlagen jedoch von dieser Regelung unberührt, was für aktuelle Anlagenbetreiber einen gewissen Schutz bietet.
Um die Rentabilität von neuen Solaranlagen dennoch zu fördern, betont Reiche, dass kleinere Anlagen von bis zu 30 Kilowattpeak auch ohne staatliche Förderung wirtschaftlich bleiben können. Des Weiteren wird empfohlen, die Installation von Stromspeichern zu erwägen, um den Eigenverbrauch zu maximieren. Beispielsweise kostet eine 10 Kilowattpeak-Anlage rund 15.000 Euro und ein Speicher etwa 7.000 Euro, was nach Mehrwertsteuerrückerstattung zu Gesamtkosten von etwa 18.500 Euro führt. Eine durchschnittliche Nutzung von 3.500 Kilowattstunden pro Jahr könnte Einsparungen von ungefähr 17.150 Euro über zwei Jahrzehnte generieren, vorausgesetzt, dass die Einspeisevergütung von mindestens 1.350 Euro erzielt wird.
Herausforderungen für zukünftige Anlagenbesitzer
Die Unsicherheiten in Bezug auf die Einspeisung von überschüssigem Strom und die Abnahme durch Netzbetreiber stellen für viele Hausbesitzer eine erhebliche Herausforderung dar. Um einen Verlust bei der Investition zu vermeiden, müssen die Netzbetreiber ihre Abnahmebedingungen klar und nachvollziehbar kommunizieren. In diesem Zusammenhang ist die Wirtschaftlichkeit besonders vom Stromverbrauch abhängig. Bei einem Jahresverbrauch von 8.000 kWh beträgt die Amortisationszeit 17 Jahre, während sich bei nur 3.000 kWh eine Amortisation von bis zu 31 Jahren ergibt.
Die Kritik an den Plänen von Reiche kommt nicht nur von den Betroffenen, sondern auch von Umweltministerin Thekla Walker, die vor einer Verunsicherung der Hausbesitzer warnt. In Baden-Württemberg besteht bereits eine Pflicht zur Installation von Solaranlagen bei Neubauten oder Dachsanierungen, was die Dringlichkeit zu unterstreicht, die Rahmenbedingungen für die Nutzung erneuerbarer Energien zu verbessern.
Änderungen des EEG 2023
Gemäß den neuen Regelungen des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) 2023 gelten für Betreiber neuer Photovoltaikanlagen keine Einspeisevergütungen mehr bei negativen Börsenstrompreisen. Betreiber bestehender Anlagen können sich jedoch freiwillig dieser Neuregelung anschließen und profitieren dabei von einer Vergütungserhöhung von 0,6 Cent pro kWh für die Einspeisung. Dies bietet einen Anreiz, die alten Technologien weiterhin wirtschaftlich zu nutzen. Informationen hierzu werden auch von Photovoltaik.org bereitgestellt.
Die Regelungen führen dazu, dass ab dem folgenden Jahr nach Installation eines Smart Meters die Abregelung bei negativen Preisen für Photovoltaikanlagen bis 100 kWp gilt. Zudem wird der 20-jährige Vergütungszeitraum bei negativen Preisen entsprechend verlängert, damit Betreiber nicht benachteiligt werden. Diese Informationen bezieht sich auf den derzeit geltenden rechtlichen Rahmen, der die Marktteilnehmer zunehmend unter Druck setzt, ihre Technologien und Investitionen genau zu planen und einzuschätzen, wie es die Energie-Experten schildern.