Ost trifft West: Musik und Identität beim taz-Panter-Preis in Bochum!
Live-Bericht über die taz-Panter-Preisverleihung in Bochum: Diskussion über Ost-West-Identität in der deutschen Musikszene.

Ost trifft West: Musik und Identität beim taz-Panter-Preis in Bochum!
Der 6. Juli 2025 steht ganz im Zeichen der Diskussion um die kulturellen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Im Rahmen der taz-Panter-Preis-Verleihung in Bochum moderiert Dennis Chiponda eine lebhafte Diskussion mit den Künstlern Simon Klemp, einem Rockmusiker aus Bonn, und Johannes Prautzsch, dem Gitarristen und Sänger der Post-Hardcore-Band Kind Kaputt. Das Thema lautet: “Einheit von Ost und West in der deutschen Musikszene”. Laut taz.de werden brennende Fragen diskutiert: Sind die Gemeinsamkeiten größer als die Unterschiede? Wie reflektieren Musiker ihre Identität in ihren Werken?
Beide Gäste bringen interessante Perspektiven mit. Simon Klemp, bekannt als der „Klaus Kinski des Stadionrocks“, wuchs in Bonn auf und durchlief einen ungewöhnlichen Werdegang in der Musik, der von Schauspielerei und einem Studium der Literatur und Philosophie geprägt ist. Im Kontrast dazu steht Johannes Prautzsch, der in Leipzig aufgewachsen ist. Seine musikalische Ausbildung wurde von seiner Großmutter gefördert, die ihn ermutigte, Klavier zu üben. Er reflektiert über klischeehafte Zuschreibungen, mit denen er im Westen konfrontiert wurde, und äußert, dass ihm diese Aspekte seiner ostdeutschen Herkunft zuvor oft nicht bewusst waren.
Kulturelle Identität und Herausforderungen
Prautzsch steht auch im Fokus, wenn es um die Wahrnehmung der ostdeutschen Identität in der Musik geht. Er hat seine eigene Herkunft lange Zeit verleugnet und gesteht, eine Scham über die Assoziation mit „Nazi-Sachsen“ empfunden zu haben. In seinen Bemühungen, Musik zu schreiben, die nicht ostdeutsch klingt, versucht er, dem Druck westdeutscher Musiker zu entkommen, die ihm nahelegten, „ostdeutsch“ zu sprechen. Klemp hingegen sieht die regionalen Unterschiede als deutlicher an als die Kategorien Ost und West und kritisiert gesellschaftliche Vereinzelung sowie ein mangelndes politisches Engagement, besonders im Kontext der Klimakrise.
Die Diskussion nimmt dabei auch gesellschaftspolitische Dimensionen an. Chiponda lenkt die Aufmerksamkeit auf die abwertenden Erfahrungen, die viele Ostdeutsche machen. Prautzsch äußert, dass er den deutschen Einheitswillen positiv bewertet, auch im europäischen Kontext. Dies steht im Einklang mit dem aktuellen Diskurs über die Bedeutung und Wahrnehmung von Ostdeutschland in der Bundesrepublik. Immerhin haben Wahlerfolge rechtsextremer Parteien in Sachsen, Brandenburg und Thüringen im Herbst 2019 das Interesse an dieser Region neu belebt, wie die Bundeszentrale für politische Bildung berichtet (bpb.de).
Gesellschaftliche Diversität und Perspektiven
Die Auseinandersetzung mit der ostdeutschen Identität ist vor allem für die nachwendegenerierte Jugend von Bedeutung. Laut einer Studie der Otto-Brenner-Stiftung fühlen sich nur 20% der jungen Ostdeutschen als „Ostdeutsche“, während 65% der Meinung sind, dass ihre Herkunft im Alltag eine Rolle spielt. Diese ambivalente Selbstwahrnehmung und die gesellschaftlichen Herausforderungen verdeutlichen, wie stark sich das Gefühl für Identität im Laufe der letzten drei Jahrzehnten gewandelt hat. Junge Ostdeutsche lehnen “ostalgische” Sichtweisen ab und erkennen gleichzeitig die Komplexität ihrer Geschichte an.
Die Diskussionen im Podcast „Mauerecho – Ost trifft West“, der wöchentlich sonntags auf taz.de und anderen Plattformen erscheint, setzen einen wichtigen Impuls, um über diese Themen zu reflektieren und eine gemeinsame Identität zu suchen, ohne die Unterschiede zu negieren. Der Dialog zwischen Ost- und Westdeutschen bleibt entscheidend, nicht nur für die Musikszene, sondern für das gesamte Gesellschaftsbild.
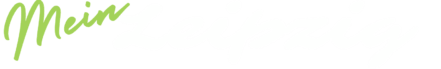
 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto
