Fünf Jahre BER: Bürgerproteste und gescheiterte Träume der Privatisierung!
Erfahren Sie alles über die umstrittene Standortwahl für den Flughafen BER in Schönefeld-Ost und die Hintergründe von Bürgerprotesten.

Fünf Jahre BER: Bürgerproteste und gescheiterte Träume der Privatisierung!
In einer umfassenden Analyse der Jahrzehnte währenden Auseinandersetzungen um den Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) zeigt sich, dass die Standortwahl von Beginn an stark politisch geprägt war. Eine ausführliche Betrachtung des Themas von entwicklungsstadt.de hebt hervor, dass bereits ein Konsensbeschluss vom 28. Mai 1996 festlegte, dass der Flughafen in Schönefeld gebaut werden sollte. Der politische Druck aus Berlin und vom Bund war dabei ebenso entscheidend wie die Untersuchungen bezüglich des Grunderwerbs, die den Beschluss beeinflussten. Im Zuge dieser Weichenstellungen kam es zur Schließung der Flughäfen Tempelhof und Tegel.
Der Weg in die komplexe Planung des Flughafens war steinig. Das Planfeststellungsverfahren begann im Dezember 1999, gefolgt von der Anpassung des Landesentwicklungsplans. Die Anwohner reagierten mit einer Flut von Stellungnahmen: Fast 5.000 Einwände und 134.000 Bürger gründeten Protestinitiativen gegen das Projekt. Trotz der massiven Widerstände genehmigte die Potsdamer Landesregierung am 13. August 2004 den Bau, setzte jedoch diverse Auflagen fest. Diese Kulisse führte zu einer Reihe von Klageverfahren, die in einem Normenkontrollverfahren mündeten, das die Landesplanung als verfassungswidrig ansah.
Rechtsstreitigkeiten und Baustopp
Die Spannungen führten 2005 zu einem Baustopp, der jedoch 2006 durch das Bundesverwaltungsgericht aufgehoben wurde, welches die Fortsetzung der Bauarbeiten erlaubte. Eine darauf folgende Verfassungsbeschwerde gegen den Planfeststellungsbeschluss wurde 2008 abgewiesen. Die politische Diskussion über die Standortwahl blieb hitzig, wobei die Brandenburger SPD Sperenberg favorisierte, während die CDU auf Schönefeld setzte und die Grünen diesen Standort ablehnten.
Die Kosten für den Bau des Flughafens stiegen im Verlauf der Jahre kontinuierlich an. Die erste Hochrechnung der Baukosten lag 1995 bei 1,112 Milliarden D-Mark. Der ursprünglich angestrebte Zeitrahmen für die Eröffnung verlagerte sich schließlich auf den 1. November 2011, nachdem sich die Privatisierungspläne mehrfach als problematisch erwiesen hatten. Schließlich saß das Konsortium um Hochtief, welches 1999 den Zuschlag erhielt, aufgrund interner Klagen und Betrugsverdachts 2000 auf der Bank.
Privatisierung und deren Herausforderungen
Auch wenn eine Privatisierung der Flughafengesellschaft und eine Zusammenarbeit mit privaten Investoren im Konsensbeschluss festgeschrieben waren, scheiterten die Pläne im Mai 2003 wegen Uneinigkeiten über die Kostenrisiken. In den 1980er Jahren erlebte Deutschland eine Wende hin zu mehr privater Initiative, wie die bpb.de beschreibt. Diese Einstellungen fassten allmählich Fuß, führten jedoch zu steigenden privaten Eigentumsanteilen und einer Verschiebung der staatlichen Verantwortung.
Das Dilemma um den Flughafen BER hat am Beispiel des Flughafens die Kritik an den Privatisierungsstrategien befeuert. So wird der staatliche Einfluss zunehmend hinterfragt, da er oft ineffiziente Prozesse und finanzielle Belastungen für die öffentlichen Haushalte mit sich bringt. Die Beispielsfälle Nürburgring, BER und Stuttgart 21 verdeutlichen diese Problematik.
Anhand dieser Entwicklung wird klar, dass der Flughafen BER zu einem Symbol für gescheiterte Privatisierungspläne und die Herausforderungen staatlichen Handelns in einem privatwirtschaftlich orientierten System geworden ist.
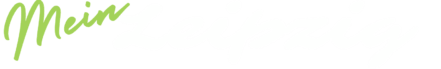
 Suche
Suche
 Mein Konto
Mein Konto
